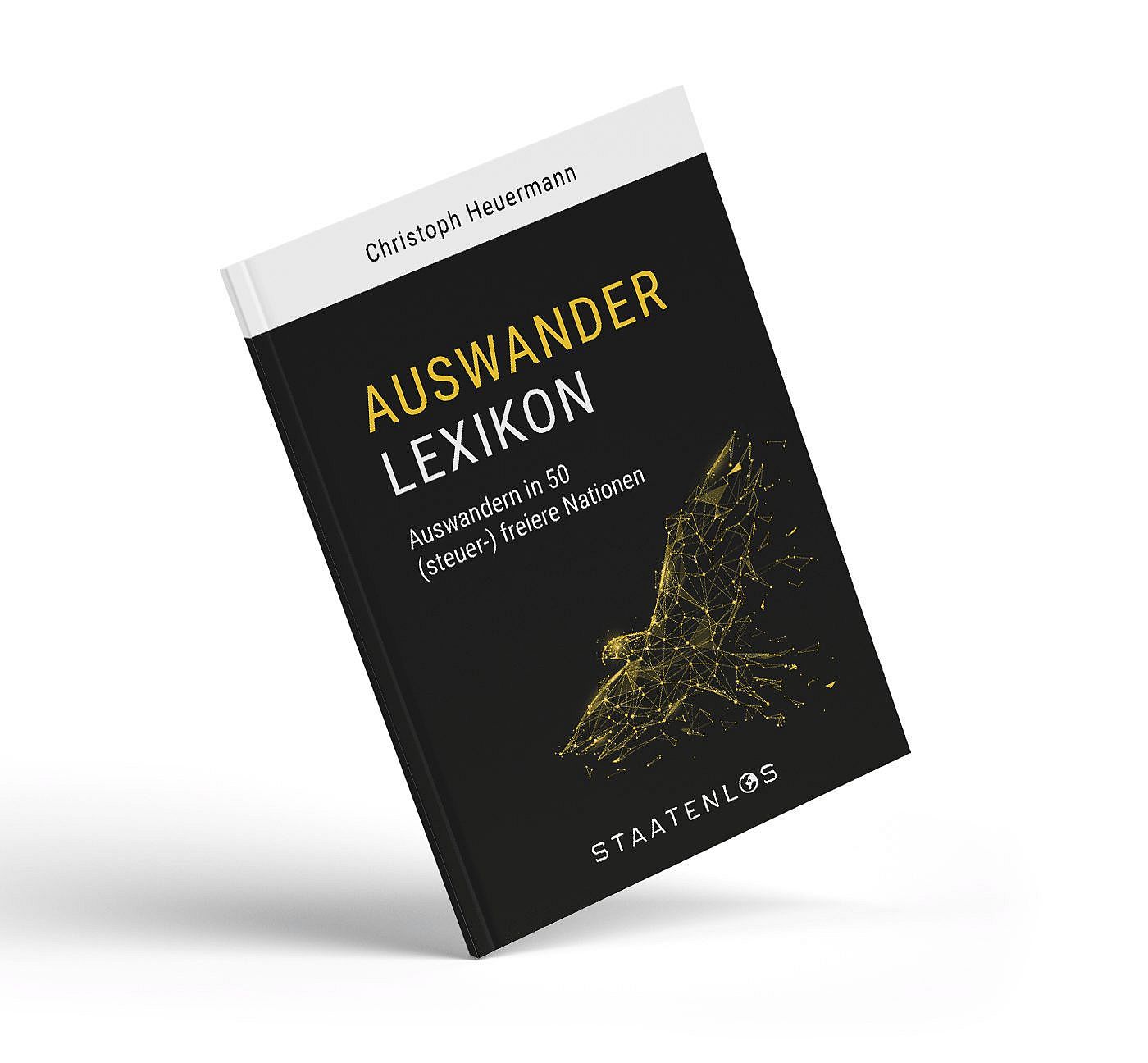„Wer sind Sie – und was haben Sie mit Friedrich Merz gemacht?“, diese Frage stellte nicht nur Deutschlands bekanntester Arbeitsloser, Christian Lindner, im Bundestag – sie dürfte auch Millionen Deutschen beschäftigen. Dass deutsche Politiker nach der Wahl unter akuter Amnesie bezüglich ihrer Versprechen leiden, ist nun nichts Neues. Doch das Tempo, mit dem die Union ihre Wahlversprechen bricht, grenzt fast schon an ein Meisterstück politischer Selbstverleugnung. Grund genug, einen genaueren Blick auf das eigentliche Thema der Debatte zu werfen – nein, nicht Wahlbetrug, sondern: die Staatsverschuldung. Und Euch, mal wieder, ein paar handfeste Gründe zu liefern, warum es vielleicht Zeit wird, die Koffer zu packen und an Orte zu gehen, die Euch nicht nur besser behandeln, sondern wo Theaterstücke noch im Schauspielhaus stattfinden.
Lange hat sich Deutschland mit der Schuldenbremse im Grundgesetz einer strikten Haushaltsdisziplin verschrieben. Diese Regel, seit 2011 in Kraft, begrenzt die Neuverschuldung des Bundes auf 0,35 % des BIP (strukturell) und soll exzessive Staatsverschuldung verhindern. Die CDU/CSU unter Führung von Friedrich Merz hatte betont, an diesem Prinzip festzuhalten – bislang.
Deutschlands „Schwarze Null“
So war die Schwarze Null bzw. die Schuldenbremse über Jahre ein – wenn auch recht trickreicher – Markenkern der konservativ-liberalen Finanzpolitik. Umso erstaunlicher war der jüngste Kurswechsel, der einem milliardenschweren „Sondervermögen“ und einer Aufweichung der Schuldenbremse zustimmte.

Deutschlands Schuldenuhr in Berlin
Die Kehrtwende kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Deutschlands Schuldenquote nach Pandemie und hausgemachter Energiekrise wieder angestiegen ist – rund 63 % des BIP im Jahr 2024. Die Befürworter des Schuldenpakets argumentieren, außergewöhnliche Bedrohungen wie der Krieg in der Ukraine erforderten Ausnahmen von der Schuldenbremse, etwa um Verteidigung und Infrastruktur zu stärken – dazu benötige es ein „Sondervermögen“.
Moment – Verteidigung und Infrastruktur? Sind das nicht eigentlich Kernaufgaben, die sich der Staat auf die Fahne geschrieben hat? Und sollte das nicht mit knapp einer Billion Euro jährlichen Steuergeldern irgendwie auskommen? Genau, knapp eine Billion Euro soll der deutsche Fiskus prognostisch im Jahr 2025 einnehmen.
In Zahlen: Wir sprechen von 1.000.000.000.000 Euro. Würde man diese Summe in 1-Euro-Münzen stapeln, reichten die Türme sechsmal bis zum Mond. Oder: Bei einem durchschnittlichen Kaufpreis von 250.000 Euro ließen sich damit vier Millionen Häuser bauen – genug, um eine ganze Großstadt zu errichten. Oder: Verteilte man das Geld gleichmäßig auf jeden Menschen dieses Planeten, bekäme jeder etwa 125 Euro.
Also kurzum: Eine Billiarde ist eine Menge Holz für die eine alte Frau lange stricken muss (um genau zu sein müsste sie bei einem Mindestlohn von 12,82 Euro pro Stunde genau 8,9 Billionen Jahre stricken – man geht davon aus, dass das Universum „nur“ ca. 13,8 Milliarden Jahre alt ist – sie müsste also über 640-mal so lange stricken, wie das Universum alt ist).
Sollten bei einer der höchsten Steuerbelastungen weltweit diese selbsternannten Kernaufgaben nicht längst erfüllt sein?
Für jeden halbwegs wirtschaftlich denkenden Menschen wäre es zumindest an der Zeit, nicht noch mehr in ein Haus zu investieren, dessen Fundament bröckelt. Es bringt wenig, immer neue Stockwerke draufzusetzen, wenn es einer strukturelle Sanierung bedarf – oder dem Abriss, bevor alles einstürzt. Leider sieht der Staat das häufig anders.
Deutschlands Selbstverständnis als ehemaliger Musterschüler solider Finanzen ist verspielt
Denn halten wir fest: Immer da, wo irgendwelche staatlichen Institutionen Ihre Finger im Spiel haben, wird es zäh, schleppend und mühselig. Es wird ineffektiv, schwerfällig und lähmend. Egal ob Baugenehmigung, Digitalisierung oder irgendein „Förderprogramm“ – was in privater Hand Wochen dauert, braucht im Behördenapparat Jahre, Formulare in fünffacher Ausführung und am Ende einen Stempel, der aus einem vertrockneten Stempelkissen kommt. Warum es also für Verteidigung und Infrastruktur mit 1 Billion Euro nicht hinhaut, könnte auch daran liegen, dass es an effizienten und schlankeren Strukturen mangelt. Bevor wir also den Blick auf andere Länder richten, lohnt es sich, die wichtigsten Aspekte gegen eine fortgesetzte Schuldenpolitik noch einmal klar zu benennen:
Steuererhöhungen und versteckte Belastungen
Steigende Schulden erfordern langfristig höhere Steuern oder Abgaben, um Zins- und Tilgungsverpflichtungen nachzukommen. Dies reduziert die individuelle Freiheit, weil den Bürgern weniger Geld zur freien Verfügung bleibt. Staatsverschuldung geht langfristig immer zu Lasten der Steuerzahler und Spielräume für Steuersenkungen werden damit verbaut. Zugleich verlagert sich der politische Fokus zunehmend auf die Bedienung alter Verpflichtungen, statt auf die Gestaltung neuer Chancen. Wer Schulden anhäuft, verschiebt nicht nur Kosten, sondern auch Verantwortung. Womit wir beim nächsten Punkt sind:
Belastung zukünftiger Generationen
Hohe Staatsverschuldung bedeutet, dass der Staat heutige Ausgaben zulasten zukünftiger Generationen finanziert. Es ist nicht nur ethisch fragwürdig, sondern schlichtweg verfassungsrechtlich problematisch, kommende Generationen mit Schulden zu belasten, die diese selbst nicht zu verantworten haben. Zumindest wisst ihr, bei wem Ihr Euch zu bedanken habt.
Fehlende fiskalische Disziplin
Höhere Staatsschulden sind oft das Ergebnis politischer Bequemlichkeit. Sie erlauben kurzfristige Verbesserung – auf Kosten langfristiger Stabilität. Wer sich einfach verschulden kann, neigt eher dazu, ineffiziente oder unnötige Ausgaben zu tätigen. Es fehlt der verantwortungsvolle und vor allem effiziente Umgang mit dem Geld der Bürger. Fiskalische Disziplin hingegen bedeutet, auch unbequeme Entscheidungen zu treffen, Ausgaben zu prüfen, Reformen anzugehen – und nicht ständig auf Pump zu leben.
Immer größerer Einfluss des Staates
Staatliches Schuldenmachen gilt als Einfallstor für immer mehr staatliche Ausgaben, Programme und Eingriffe – was die Freiheit des Einzelnen gefährdet. Der Einfluss des Staates auf Wirtschaft und Gesellschaft lähmt sämtliche positive Dynamik und führt zwangsläufig zu wachsender staatlicher Macht und Einflussnahme auf genannte Lebensbereiche. Je tiefer ein Staat in Wirtschaft und Gesellschaft eingreift, desto mehr geraten private Entscheidungen unter öffentlichen Vorbehalt. Freiheit wird zunehmend durch Planbarkeit ersetzt – mit der Folge, dass Menschen sich nicht mehr als selbstbestimmte Akteure, sondern als „Verwaltete“ im System erleben.
Je höher die Schulden, desto weniger Reformen
Was Deutschland fehlt, sind längst überfällige strukturelle Reformen – doch statt diese mutig anzugehen, werden sie durch neue Schulden übertüncht. Der politische Druck, Staatsapparate zu verschlanken, Bürokratie abzubauen und Effizienz zu schaffen, schwindet mit jedem zusätzlichen Milliardenpaket. Es fehlt der Druck, Staatsstrukturen zu reformieren oder zu beseitigen, Bürokratie abzubauen, Effizienz zu etablieren.
Und sind wir ehrlich: Bei den derzeitigen Staatseinnahmen müsste Deutschland über Straßen von Weltklasse verfügen, eine hochmoderne, effiziente Verwaltung besitzen – und Krankenhäuser und Schulen die aus Marmor gebaut sind. Doch anders als bei einem privaten Investment fehlt im Steuerrecht die Möglichkeit, sich bewusst gegen eine weitere Finanzierung dieses Systems zu entscheiden – zumindest, wenn man im Land leben bleiben möchte. Ansonsten würden viele ihr Geld wohl kaum in ein Modell investieren, das seit Jahrzehnten auf der Stelle tritt – und das nun durch ein sogenanntes „Sondervermögen“ notdürftig neu verputzt wird, obwohl die Mauern längst Risse haben.
Natürlich gibt es dennoch Wege, sich der endlosen Steuerlast und der Finanzierung eines Systems zu entziehen, das längst mehr kostet, als es leistet. Seit über einem Jahrzehnt sind wir darauf spezialisiert, genau dabei zu helfen – effizient, legal und mit dem nötigen Weitblick. Wir zeigen Dir, wie Du Dich Schritt für Schritt von einem maroden Apparat löst, der unbeirrt Richtung Abgrund steuert.
Wir zeigen Dir außerdem im Vergleich, wie es in anderen Ländern ausschaut.
Zum Vergleich: Deutschland weist im Jahr 2024 eine Staatsverschuldung von ca. 63 % des BIP auf. Damit liegt die Schuldenquote Deutschlands über dem selbst auferlegten Maastricht-Grenzwert von 60 %. Die Konjunktur entwickelt sich schleppend – die deutsche Wirtschaft schrumpfte 2024 real um 0,2 % – ein geringfügiger Rückgang, der insbesondere auf hohe Energiepreise und eine schwache Industrie zurückgeführt wird.
Trotz des Wirtschaftsabschwungs erhöhte sich das staatliche Budgetdefizit leicht: Der Haushaltssaldo betrug etwa –2,8 % des BIP. Diese Defizitquote überstieg den Wert von 2023 (–2,5 %) und spiegelt expansive Maßnahmen zur Abfederung der Energiekrise wider. Wirtschaftspolitisch steht Deutschland damit am Scheideweg: Einerseits bleibt die Schuldenquote dank früherer Konsolidierungsschritte moderat, andererseits deutet das erneute Defizit in einer Phase wirtschaftlicher Stagnation auf begrenzten fiskalischen Spielraum hin.
Deutschland hat im internationalen Vergleich damit aktuell weder eine besonders niedrige Schuldenquote noch ein dynamisches Wachstum vorzuweisen. Die fiskalische Situation ist zwar in 2024 noch unter Kontrolle, doch die Kombination aus bereits mittelhoher Verschuldung und wirtschaftlicher Stagnation werfen aber nun einmal Fragen zur zukünftigen Stabilität und Reformfähigkeit auf. Das neue „Sondervermögen“ stand zu dem Zeitpunkt noch gar nicht zur Debatte.
Norwegen
Norwegen weist im Vergleich zu Deutschland eine niedrigere Staatsschuldenquote auf, die 2024 etwa 43 % des BIP betrug. Trotz dieses ohnehin im Vergleich zu Deutschland geringeren Werts ist zu beachten, dass Norwegen enorme Staatsfonds-Vermögen besitzt – netto ist der Staat also wesentlich weniger verschuldet. Die Wirtschaft Norwegens wuchs 2024 real um 2,1 % (Gesamt-BIP; Festland-Norwegen ohne Öl/Gas immernoch +0,6 %). Haupttreiber war die hohe Aktivität im Öl- und Gassektor, die eine schwächere Konsum- und Baunachfrage mehr als ausglich.
Fiskalisch erzielt Norwegen dank Öleinnahmen einen hohen Haushaltsüberschuss: 2024 überschritt der Gesamtstaatsüberschuss 13 % des BIP (rund 688 Mrd. NOK). Dieses enorme Plus – leicht geringer als im Vorjahr – unterstreicht die ausgezeichnete Haushaltslage. Wirtschaftspolitisch nutzt Norwegen die Öl-Erlöse vorsichtig gemäß der Fiskalregel (max. 3 % des Fondsvermögens jährlich), was Stabilität gewährleistet. Die Haushaltsführung ist vorbildlich: Dank Überschüssen konnte Norwegen seine ohnehin niedrige Schuldenquote weiter senken. Die Kombination aus Wachstum und Überschüssen spricht für eine sehr hohe finanzpolitische Stabilität und Flexibilität für zukünftige Reformen.
Schweiz
Die Schweiz weist traditionell eine sehr geringe Staatsverschuldung auf. Die Maastricht-Schuldenquote des Gesamtstaats lag 2024 bei lediglich rund 32 % des BIP. Damit hat die Schweiz eine enorm niedrige Verschuldung, die sich noch einmal im Nettovergleich reduziert. Gleichzeitig wuchs die Schweizer Wirtschaft 2024 um +0,8 % real, weniger dynamisch als 2023 (+1,2 %). Die schleppende Entwicklung wichtiger Handelspartner und ein nur moderates Wachstum im Dienstleistungssektor bremsten die Konjunktur, gleichwohl stützte die boomende Pharmaindustrie das BIP-Wachstum maßgeblich.
Fiskalisch glänzt die Schweiz durch strikte Haushaltsdisziplin: Dank der Schuldenbremse erzielte der Bund 2024 praktisch einen ausgeglichenen Haushalt (Finanzierungsdefizit nur 80 Mio. CHF). Die Staatsausgaben blieben im Einklang mit den Regeln, so dass trotz Konjunktureintrübung kein nennenswertes Defizit entstand. Die Schweiz vereint sehr niedrige Schulden mit hoher Stabilität. Das knappe Haushaltsresultat zeigt eine umfassende finanzielle Solidität, die dem Land erheblichen Spielraum für zukünftige Herausforderungen gibt. Reformvorhaben – etwa im Sozialwesen oder Klimabereich – können aus einer Position der Stärke angegangen werden, ohne die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen zu gefährden.
Südkorea
Südkorea hatte 2024 eine Staatsverschuldung von etwa 53 % des BIP. Die Quote liegt damit eher in einem mittleren Bereich – deutlich höher als bei Norwegen oder der Schweiz, aber unter den Werten vieler westlicher Industrieländer. Das koreanische BIP wuchs 2024 real um 2,0 % und übertraf damit das schwache Vorjahr (1,4 %). Fiskalisch gelingt es Südkorea, seine Defizite gering zu halten: Für 2024 wurde ein Haushaltsdefizit von etwa –1,8 % des BIP angepeilt.
Südkorea zeigt eine umsichtige Budgetpolitik mit relativ niedriger Verschuldung und nahezu ausgeglichenem Haushalt. Die Schuldenquote steigt zwar tendenziell (wegen Demografie und Konjunkturprogrammen), bleibt aber dank solide wachsender Wirtschaft und diszipliniertem Haushalt unter Kontrolle. Die Regierung verfügt über haushaltspolitische Stabilität und kann Reformvorhaben (z.B. Sozialausgaben für die alternde Gesellschaft) angehen, ohne die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen zu gefährden.
Neuseeland
Neuseelands Schuldenquote lag 2024 bei etwa 47 % des BIP und damit etwas unter der Südkoreas. Dieses Niveau stellt für Neuseeland einen deutlichen Anstieg gegenüber der Vor-Covid-Ära dar (vor 2020 <30 %), ist aber im internationalen Vergleich immer noch moderat. Die neuseeländische Wirtschaft verzeichnete 2024 einen leichten realen Rückgang von ca. –0,5 %. Nach technischen Rezessionstendenzen in 2023 stagnierte die Wirtschaft, was vor allem auf hohe Zinsen und zurückhaltenden Konsum zurückzuführen ist.
Fiskalisch schreibt Neuseeland weiterhin rote Zahlen: Seit 2019/20 besteht ein durchgängiges Staatsdefizit . Für 2024 ergibt sich ein Finanzierungsdefizit von grob 3 % des BIP (OBEGAL ca. 12,9 Mrd. NZ$) – allerdings etwas niedriger als im Vorjahr, da die Regierung Ausgaben bremste. Die Haushaltsführung Neuseelands ist grundsätzlich solide (Schuldenbremse vorhanden), doch die wirtschaftliche Stabilität litt zuletzt unter externen Schocks (Pandemie, Naturkatastrophen). Trotz negativer Wachstumrate blieb das Defizit maßvoll, was auf Ausgabendisziplin hindeutet. Die Reformfähigkeit zeigt sich etwa im Bestreben, mittelfristig wieder Überschüsse zu erzielen und die Schuldenquote zu senken. Insgesamt steht Neuseeland finanziell auf relativ robustem Fundament.
Dänemark
Dänemark gehört zu den fiskalisch stärksten Ländern Europas. Die dänische Schuldenquote sank 2024 auf nur noch etwa 28 % des BIP und liegt damit sogar etwas unter dem bereits niedrigen Niveau der Schweiz. Gleichzeitig boomte die Wirtschaft: Das BIP wuchs 2024 real um 3,6 % – ein für Dänemark ungewöhnlich hoher Wert, begünstigt durch einen Export-Boom der Pharmaindustrie und robuste Binnennachfrage. Diese Wachstumsrate markiert eine deutliche Beschleunigung gegenüber 2023 (1,2 %). Die öffentlichen Finanzen profitierten massiv von der guten Konjunktur und sprudelnden Unternehmenssteuern (insb. von Pharmaunternehmen).
Für 2024 meldete Dänemark ein Rekordüberschuss von 133,2 Mrd. DKK auf allen Staatsebenen – das entspricht grob 4,5 % des BIP, eine weitere Steigerung gegenüber dem ohnehin hohen Überschuss 2023 (3,3 % des BIP). Damit übertrifft Dänemark die Maastricht-Kriterien bei weitem und verfügt über beträchtliche fiskalische Puffer. Dänemarks Haushaltsführung ist exzellent. Die wirtschaftliche Stabilität wird durch geringe Schulden und hohe Überschüsse untermauert. Das Land nutzt die Spielräume gezielt ohne die langfristige Nachhaltigkeit zu gefährden. Insgesamt unterstreicht Dänemark seine Reformfähigkeit dadurch, dass es in wirtschaftlich guten Zeiten Überschüsse erwirtschaftet und Schulden abbaut – ein Polster, das für zukünftige Herausforderungen (z.B. demografischer Wandel) wichtig ist.
Vereinigte Arabische Emirate
Die Vereinigten Arabischen Emirate präsentierten 2024 eine Staatsschuldenquote von rund 31 % des BIP, was im Ländervergleich ordentlich ist. Die Ratingagentur Fitch bewertet den Schuldenstand der Emirate als „moderat“ und verweist auf umfangreiche Staatsvermögen und hohe Pro-Kopf-Einkommen. Die Wirtschaft der VAE expandierte im Jahr 2024 kräftig: Das reale BIP wuchs um etwa 3,7 %. Angetrieben wurde die Dynamik vor allem durch den Nicht-Öl-Sektor (u.a. Tourismus, Bau, Finanzdienste), während gekürzte OPEC-Ölfördermengen das Öl-BIP leicht dämpften.
Fiskalisch stehen die Emirate gewohnt solide da. Der Staatshaushalt wies 2024 einen Überschuss von ca. 4 % des BIP auf – etwas geringer als im Vorjahr, aber weiterhin deutlich positiv. Sowohl Abu Dhabi als auch Dubai erzielten Überschüsse, sodass die Defizite kleinerer Emirate wie Sharjah überkompensiert wurden. Wirtschaftspolitisch zeigen die VAE eine bemerkenswerte Stabilität: Die relativ niedrige Verschuldung und anhaltenden Haushaltsüberschüsse trotz Schwankungen beim Ölpreis belegen eine umsichtige Finanzpolitik. Dank hoher Öl- und Investmenteinnahmen konnten Reserven aufgebaut werden (AA–Rating bestätigt dies). Dies verschafft den Emiraten erhebliche Reformfähigkeit, etwa um die Diversifizierung der Wirtschaft weiter voranzutreiben, ohne fiskalische Risiken einzugehen.
Es zeigt sich also: Die steigende Staatsverschuldung mit dem essenziellen Wortbruch der Union stellt eine ernsthafte Gefahr für die Freiheit und wirtschaftliche Stärke Deutschlands dar. Sie erzeugen Fehlanreize, behindern den effizienteren Privatsektor, fördern politische Verantwortungslosigkeit und begrenzen sowohl individuelle Freiheit als auch langfristige Handlungsspielräume. Schlechter geht es natürlich immer, aber dass es besser geht, zeigen zahlreiche andere Länder. Am besten ist aber immernoch: Nimm deine Freiheit selber in die Hand. Wir helfen Dir gerne dabei und beraten Dich zu den besten Möglichkeiten für deine individuellen Bedürfnisse.
Dir hat unser Blogartikel gefallen?
Unterstütze uns mit einem Erwerb unserer Produkte und Dienstleistungen. Oder baue Dir ein passives Einkommen mit ihrer Weiterempfehlung als Affiliate auf! Und vergiss nicht auf Christophs Reiseblog christoph.today vorbei zu schauen!
Videokurs Staatenlos Geheimwissen
Lerne alles, was Du für ein Perpetual Travel Leben wissen musst.
Kurs anschauen